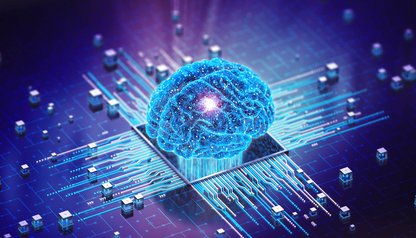Vor exakt 40 Jahren trafen sich Techniker von Sony und Philips, um die Standards für eine Revolution zu fixieren: für die „Compact Disc“, kurz „CD“. Sie sollte Musik in der Länge von 74 Minuten spielen können. Als Maßstab diente das längste verfügbare Musikstück, eine Schallplattenaufnahme der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, dirigiert von Wilhelm Furtwängler. Zwei Jahre später kamen die ersten CDs auf den Markt. Sie kosteten umgerechnet etwa 20 Euro pro Stück, der CD-Player dazu zwischen 400 und 1.000 Euro. Wer jetzt im Beethoven-Jahr 2020 die „Neunte“ hören will, fragt kaum noch nach Schallplatte oder CD, sondern nutzt einen Streaming-Dienst wie Spotify, Amazon-Music, YouTube Music, Deezer, Tidal und Co. Die Musik wird über das Internet gestreamt, also abgespielt ohne dauerhaftes Herunterladen der Daten. Das Hörerlebnis gibt es in der Basisversion meist kostenlos, als Abspielgerät fungieren Handy, Computer oder Fernseher. Zur Auswahl stehen heute etwa 50 Millionen verschiedene Musiktitel. Fast 300 Millionen Nutzer pro Monat hat alleine Spotify, davon etwa die Hälfte zahlende Kunden (Quelle: statista.de).
Der Schlüssel zum Erfolg
Damit sich diese Dienste rechnen, werden Abonnements verkauft bzw. bei Gratis-Angeboten zwischendurch Werbespots eingestreut. Auf Wunsch und kostenpflichtig ist auch ein dauerhafter Download der Musik möglich. Der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg liegt dabei wie so oft im persönlichen Service. Einst informierte der Verkäufer im Plattenladen des Vertrauens beiläufig, welches neue Album am Vortrag eingetroffen war. Heute schlagen digitale Plattformen systematisch vor, was dem Nutzer gefallen könnte. Algorithmen werden auch in der Musikindustrie zum Filtern, Klassifizieren und Priorisieren von Inhalten verwendet und laufend weiterentwickelt. Solche Technologien, ihre Auswirkungen und ihren Nutzen für die Menschen erforscht Mag. DI Dr. Christine Bauer an der Johannes-Kepler-Universität Linz. „Hinter Empfehlungssystemen steht kein einfacher und eindeutiger Prozess, sondern viel ‚trial and error‘, Versuch und Irrtum. Die Plattformen probieren im System unterschiedliche Algorithmen, und dann wird verglichen, was besser funktioniert.“

Andere Kunden hörten auch
Eine gängige Methode heißt „Collaborative filtering“. Die Plattform beobachtet das Hörverhalten des Kunden, sucht nach anderen Nutzern, die ähnliche Stücke hören, und schlägt deren Favoriten dem Kunden vor. Der Vorgang basiert auf einer umfangreichen Datenbank und funktioniert wie in vielen Onlineshops nach dem Motto „Andere Kunden kauften auch bzw. interessierten sich auch für …“ Parallel dazu läuft die Kontrolle im Hintergrund gleich mit. „Die Plattform trifft Vorhersagen und testet sofort, ob die Vorhersage dann mit dem tatsächlichen Nutzerverhalten zusammenpasst. Das geht im Echtbetrieb mit Usern.“ Im Grunde also wie der gute Verkäufer im Plattenladen, der unmittelbar sieht, ob sein Vorschlag beim Kunden ankommt oder nicht.
Typische Merkmale von Musik
„Content based filtering“ hat eine andere Qualität. Hier werden quasi nicht Listen oder Titel verglichen, sondern der musikalische Inhalt. „Wenn der User ein Stück gehört und geliked hat, wird anhand des Contents ein ähnliches Stück gesucht“, erläutert Christine Bauer. Die Herausforderung für die Plattform liegt darin, typische Merkmale von Musik in Formeln zu packen und in eine Matrix zu legen. Lautstärke oder Tempo lassen sich messen, Epochen, Musikstile oder Genres ordnen – aber wie definiert sich eine gute Melodie? Um herauszufinden, worauf Hörer achten, werden von den Plattformen eigene Nutzer-Befragungen durchgeführt.
Musik im Kontext der Nutzung
Ein weiterer Ansatz geht beispielsweise auf den Nutzungszeitpunkt ein: „Plattformen bieten ruhige Abendmusik oder ‚Energy in the morning‘. Der Kontext ist entscheidend, gepaart mit dem, was der User so mag.“ Das kennen Nutzer auch vom Radio. „Wann und wie Radio gehört wird, hat bestimmte Szenarien, zum Beispiel im Hintergrund bei der Büroarbeit.“ Auch der Ort, an dem sich der Nutzer aufhält, oder sein Puls können Kriterien sein. Spotify etwa bietet Playlists zum Workout oder für die Dusche. Dem steht quasi am anderen Ende des Spektrums der Verzicht auf mathematische Methoden gegenüber. Unter dem Motto „Editorial“ präsentieren Nutzer einfach ihre persönliche Playlist. Schließlich gibt es „hybride Mischungen“ aus allen Methoden.
Land und Kulturkreis
Die Einbeziehung von Nutzern und Künstlern ist Christine Bauer ein besonderes Anliegen. In ihrem aktuellen Projekt fragt sie Künstler, was sie unter einem fairen System verstehen. „Derzeit wird einfach eine Annahme getroffen, ohne zu fragen.“ Ein Problem der globalen Algorithmen ist der „popularity bar“ im Collaborative Filtering. „Jemand hat ein Stück gut gefunden, daher wird es weiterempfohlen. Unpopuläre Musik wird nicht vorgeschlagen.“ Beispielsweise ist das südkoreanische Genre „K-Pop“ weltweit das siebtmeist gehörte Genre, aber in Österreich nicht relevant. Christine Bauer möchte eine stärkere Berücksichtigung der kulturellen Diversität: „Algorithmen sollen stärker den eigenen Kulturkreis einbeziehen.“
Grenzen des Systems
Dazu stellt sich aber auch gleich die Frage: „Wie weit soll ein Algorithmus eingreifen? Vielleicht mag ich ja gar keinen Austropop.“ Christine Bauer ist selbst eine ausgezeichnete Musikerin, hat Jazz-Saxophon studiert und für die AKM (Verwertungsgesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikerleger) gearbeitet. „Ich habe ein paar Songs von meiner Lieblingssaxophonistin Candy Dulfer abgespielt. Das System hat sie als Niederländerin erkannt, daraufhin sind viele Songs auf holländisch gekommen. Ich habe dann Marilyn Manson gewählt, der Algorithmus ist aber bei holländisch geblieben“, schildert die Forscherin und ergänzt mit einem Schmunzeln: „Man muss das Vorgeschlagene ja nicht verwenden.“ Musikempfehlungssysteme seien eine „black box“, was sie genau wissen, können Nutzer nicht sehen. „Man kann nur Vermutungen anstellen anhand dessen, was sie liefern.“ Generell seien Daten von Empfehlungssystemen „extrem anonymisiert“.
Reaktion von Künstlern
Die Musikindustrie gilt als komplexes Machtgefüge. Neben den drei früheren Akteuren Künstler, Labels (Produzenten/Verlage) und Konsumenten hat sich ein vierter Stakeholder etabliert: die Streaming-Plattformen, wobei inzwischen viele Musikverlage auch Teilhaber solcher Plattformen sind. In Forschungsinterviews beobachtet Christine Bauer eine wachsende Reaktion von Künstlern: „Es gibt ein starkes Bestreben, sich selber auf die Beine zu stellen und mit dem Gesamtgefüge so zu arbeiten, dass man dorthin kommt, wo man hinmöchte. Fairness ist ein subjektives Empfinden, viele haben den Wunsch nach Veränderung geäußert.“
Neue Wege zum Erfolg
Künstler seien aber unterschiedlich aktiv, mit unterschiedlichen Möglichkeiten der Mitsprache. Christine Bauer wünscht sich, dass die Plattformen regionale Musik und Künstler stärker forcieren. „Als Österreicherin bin ich für österreichische Musik. Es gibt viele Playlists, die zeigen, was sich alles tut.“ Angesichts der Auswirkungen des Corona-Virus sei jetzt ein guter Moment, auch mehr österreichische Musik im Radio zu spielen. „Derzeit ist eine positive Entwicklung spürbar. Viele Künstler meinen, mit eigenen Stücken kommt man nicht so leicht an seine User. Man muss neue Wege finden, etwa über Radio, dann wird man auch auf Plattformen gespielt.“
Möglichkeiten auswählen
Für den Nutzer haben alle Wege ihren Reiz. „Personalisierte Inhalte bedeuten, jeder konsumiert etwas anderes. Da hat man aber kein gemeinsames Thema. Mainstream und Popularitätsfaktor bringen auch etwas zum Reden. Die Frage ist, ob man die Verantwortung total dem Einzelnen überlässt oder Reflexion und Hilfestellung anbietet.“
Neue Interessen oder die Weiterentwicklung des eigenen Musikgeschmacks seien nicht unmöglich. „Für das eigene Finden kann ein System helfen, auch in andere Ecken reinzuhören“, erklärt Christine Bauer. „Vor den Algorithmen war das auch so, allerdings mit dem Radio.“ Das war immer auch eine Chance für Neues: „Man nimmt, was das Radio gerade ausspielt“. Außerdem seien einst wie heute Freunde wichtig für Empfehlungen.
Menschen einbeziehen
Am Ende gilt: „Ich entscheide: Das ist etwas für mich, oder auch nicht.“ Wenn Christine Bauer unterwegs ist, hört sie im Auto einfach Radio, in Zug, Straßenbahn oder Supermarkt meist Musik von ihrem Smartphone. „Da habe ich einen stabilen Pool, eine Download-Sammlung und Titel, die ich von CDs konvertiert habe.“ Zu ihren Lieblings-Genres gehören Funk, auch Pop und Jazz. „Daheim nehme ich mir Zeit. Ich höre bewusst zu, womit sich ein Künstler beschäftigt.“ Aktuelle Favoritin ist die Wiener Band „Spitting Ibex“. Auf ihre persönliche Zukunft angesprochen, antwortet Christine Bauer philosophisch: „Ich sehe mich in einer Welt, wo es selbstverständlich ist, dass man den Menschen von Anfang an einbezieht, wenn man technische Systeme baut, ohne das hinterher rechtfertigen zu müssen.“

Über Christine Bauer
Mag. DI Dr. Christine Bauer ist Wissenschaftlerin und forscht an intelligenten Systemen mit dem Ziel, dass diese den Menschen und der Gesellschaft dienen. Der aktuelle Schwerpunkt liegt auf Musikempfehlungssystemen. Ihr im Elise-Richter-Programm gefördertes Projekt hat sie ab 2017 ans Institut für Computational Perception der Johannes Kepler Universität Linz gebracht.
Sie promovierte in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, hat einen Masterabschluss in Wirtschaftsinformatik sowie einen Abschluss im Diplomstudium Internationale Betriebswirtschaftslehre. Die gebürtige Burgenländerin ist Autorin von mehr als 90 Publikationen. Vor ihrer akademischen Karriere arbeitete sie in der österreichischen Verwertungsgesellschaft AKM. Ihr musikalischer Weg führte von Blockflöte und Akkordeon zum Saxophon und damit von jugendlicher Blasmusik zu vielfältigen Bandprojekten und zum Studium des Jazz-Saxophons.
Fit für alle digitalen Anwendungen! Mit dem garantiert schnellen Glasfaser-Internet von LIWEST.